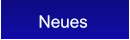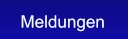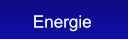Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Neue Airbus Strategie…

Siemens entwickelt
sich zum Leader
Anders als auf großen Luftfahrtmessen hat
die führende General Aviation Messe
AERO das Thema der elektrischen Luft-
fahrtantriebe schon sehr früh erkannt und
umgesetzt. Flugzeughersteller wie auch
Entwickler und Hersteller von E-Motoren,
Controller und Batteriemanagement-Syste-
men sind die Schlüssel zu einer vernünf-
tigen Integration der elektrischen Antriebs-
stränge. Siemens hat bereits eine eigene
Entwicklungsabteilung für Luftfahrtantrie-
be, sucht aber nun vermehrt die Nähe zu
den Luftfahrzeugherstellern. Nach einer
ersten zögerlichen Präsentation im Jahr
2015 trumpfte man dieses Jahr gleich mit
einem großen Sonderstand auf der e-flight
Expo auf, um über den Fortgang der Ent-
wicklungen die Besucher zu informieren.
Kurz zuvor gab Siemens mit Airbus bereits
bekannt, dass man in München eine ge-
meinsame Entwicklungsfirma auf die Beine
stellen will, bei der ein hybrider Antriebs-
strang im 10 MW-Bereich für zukünftige
Kleinverkehrsflugzeuge mit einer Kapazität
von 60-100 Sitzen ent-wickelt werden soll.
Mit dem UL/LSA-Trainer eFusion aus
Ungarn konnte man bereits über den Erst-
flug berichten. Mit großer Spannung wer-
den anschließend auch die Ergebnisse mit
Extras 330 LE erwartet. Erst in der ersten
Denkphase befindet sich die Inte-gration
eines Elektroantriebs in einen Koaxial-
Hubschrauber der Firma Aerotec.


Studie für E-Motor im Hubschrauber
Mockup der kompletten Antriebseinheit
für Diamond DA-40
Siemens-Stand auf der AERO 2016. Im Vordergrund Extra 330 LE. Rechts oben ungarischer Trainer eFusion.

Joe Kaeser
Tom Enders
Foto: Siemens
Vertrag zwischen Airbus und Siemens über mehrere hundert Millionen
Was ist eigentlich dran an diesem „Jahr-
hundert-Vertrag zwischens Siemens und
Airbus, den seine beiden Vorstände am
7. April in München unterzeichneten?
Zwar engagierten sich beide Firmen
schon gemeinsam in den vergangenen
Jahren an kleineren gemeinsamen Pro-
jekten, wie an der Katana und dem E-
Fan, doch jetzt möchte man richtig Nägel
mit Köpfen machen. Für beide Global
Player steht viel auf dem Spiel, denn
noch zehren sie von Althergebrachten.
Natürlich möchte man auch noch morgen
und übermorgen in der oberen Liga mit-
mischen, auch wenn als vordringliches
Ziel die Reduzierung der Treibhausgase
als primäre Aufgabe angegeben wird.
Nein, hier geht es jetzt um Geld, um
vielmehr Geld. Mit mehreren hundert Mil-
lionen Euro bereitgesteller Mittel inves-
tieren diese Firmen in ihre eigene Zu-
kunft. Trotz zur Zeit niedriger Ölpreise
weiß man um den letzten Tropf-en Öl,
der schon in einigen Jahrzehnten nur
noch unter großem Aufwand förderbar
sein wird. Strahltriebwerke werden zum
Auslaufmodell. Die Flugzeuge der Zu-
kunft werden nach Übereinstimmung
aller Experten nur noch Elektroflugzeuge
sein können, da keine andere Alterna-
tiven erkennbar sind. Anerkennend
äußerte sich schon im letzten Jahr der
Airbus-Vorstand gegenüber den kleinen
Entwicklern, die in geduldsamer Fein-
arbeit erste brauchbare ein- und zwei-
sitzige Flugzeuge entwickelten und die
sich durchaus als elektrisch angetriebene
Flugzeuge für spezielle Aufgaben eigne-
ten. Darauf möchte man jetzt aufbauen.
Erst die Flugzeuge für die Allgemeine
Luftfahrt entwickeln und dann Schritt für
Schritt zu den Kleinverkehrsflugzeugen
durchstarten, das ist vordringliches Ziel
dieser Konzerne! Kompromisse sind an-
gesagt,- noch keine reinelektrisch ange-
triebene Maschinen, eher Hybridlösun-
gen, wie jetzt die HYPSTAIR, die erst-
mals auf der AERO in Friedrichshafen
gezeigt wurde, ebenfalls ein mit Siemens
realisiertes Projekt. Das Vertragswerk
darf deshalb als richtiger Schritt in die
Zukunft gesehen werden. Die jetzt erst
noch zu investierenden Millionen werden
sich dann aber um ein bezahlt machen.
Foto: H.Penner
Foto: H.Penner
Foto: H.Penner


Auf Anregung des DLR, der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren, der 14 DLR-Institute und 20
Universitätsinstitute an den vier Stand-
orten Berlin, Braunschweig, Stuttgart und
München/Oberpfaffenhofen angehören,
wurde anlässlich der ILA 2016 in Berlin am
3. Juni eine Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit getroffen. Zu den Unterstützern
auf industrieller Seite gehören die Airbus
Group und Siemens. Weitere Firmen ha-
ben bereits Interesse an einer Mitarbeit
bekundet. Die Unterzeichner bekundeten
in der Erklärung ihr gemeinsames Inte-
resse am Thema elektrischen Fliegen. Ziel
sei es, die Zusammenarbeit zwischen den
Forschungseinrichtungen der Helmholtz-
Initiative DLR@Uni Electric Flight und den
Vernetzte Kooperation
Vertrag zwischen den Forchungsinstitutionen und der Industrie am 3. Juni auf der ILA
industriellen Kooperationspart-nern zu
strukturieren und einen rechtlichen Rah-
men vorzubereiten, der es den Industrie-
partnern ermöglich, mit der Helmholtz-
Initiative zusammenzuarbeiten. Das
Budget der Helmholtzgesellschaft beträgt
knapp 4 Milliarden Euro, wobei der
luftfahrtbezogenen Anteil jedoch nur we-
nige Prozente ausmacht. Der größere
Teil der Gesellschaft wird durch die
öffentliche Hand finanziert. Die Focus-
sierung der Helmholtz-Initiative
DLR@Uni Electric Flight dürfte auch
schneller zu umsetzbaren Ergebnissen
führen, die, so Dr. Frank Anton, Leiter
Electric Aircraft bei Siemens in Berlin so
formulierte: "Wir entwickeln hybride
Elektroantriebe für Luftfahrzeuge". "Mit
dem DLR wollen wir nun in eine stra-te-
gische Partnerschaft zwischen Industrie
und Wissenschaft eintreten. Mittelfristig
halten wir hybrid-elektrisch angetriebene
Regionalflugzeuge mit bis zu 100 Passa-
gieren für realistisch."
Die Initiative DLR@Uni Electric Flight
wird mit drei inhaltlichen Schwerpunkten
an den Start gehen: Technologie und
Konfiguration von Fluggeräten,
Validierung von Teiltechnologien im
Flugexperiment sowie Betrieb,
Infrastruktur und gesellschaftliche
Akzeptanz von elektrisch betriebenen
Flugzeugen.

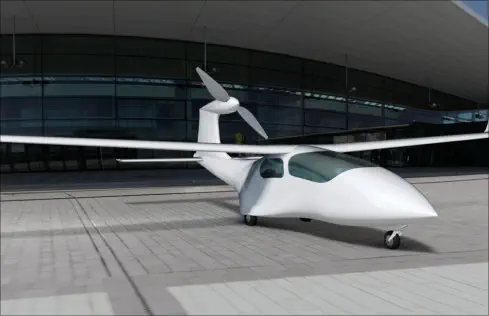
Swiss Flugkapitän und Milizionär-Hub-
schrauber Pilot Rolf Stuber hat seine Idee
des viersitzigen Smartflyers mit Hybridan-
trieb weiter forcieren können. Ein erstes
Versuchsmuster soll mit Unterstützung
durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL) realisiert werden. Die Hilfe basiert
zu einem großen Teil über die Spezialfi-
nanzierung Luftfahrt, gemäß der Schwei-
zer Bundesverfassung Artikel 86. Im Früh-
jahr gründete Stuber eine AG nach
Schweizer Recht. Zunächst sind 1,2 Mio
Franken veranschlagt.
Als erfahrener Pilot setzt Stuber aber
nicht auf einen konventionellen
Viersitzer mit Hybrid-
Antrieb in der Vor-
Planungsphase
Smartflyer-Projekt in der Schweiz wird konkreter
Kolbenantriebe, sondern auf einen Hy-
bridantrieb. Inspiriert durch das Stutt-
garter Projekt des e-Genius sollen drei
Hauptkomponenten, ein kleiner Verbren-
nungsmotor mit Generator für den Dauer-
betrieb, ein Batteriesystem und ein Elek-
tromotor die Basis des Kunststoffflug-
zeugs bilden. Desgleichen schwört er auf
ein Fallschirm-Gesamtrettungsystem.
Der Reiseviersitzers soll nur 1/3 des üb-
lichen Schadstoffausstosses produzie-
ren. Nach dem bis 2020 fertig zu stel-
lenden Proof-of-Concept (bei MSW
Aviation in Wohlen) ist an den Serienbau
der Maschine gedacht.
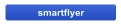

Techn Daten: Smartflyer
Abmessungen
Spannweite:12 m
Länge: 8,30 m
Höhe: 2,70 m
Flügelfläche:13 m²
Flügelstreckung:11,07
Massen
Leermasse: 800 kg
Abflugmasse: 1120 kg
Zuladung: 320 kg
Antrieb: Hybrid
Elektromotor: max. 160 kW
konst. Leistung: 120 kW
Pufferbatterie. Li-Io.
Motor-Generator: Rotax 914
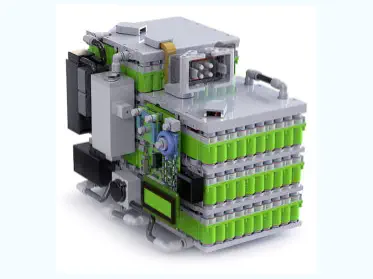
Die Reichweite eines e-Golf von 190 auf
430 Kilometer erhöhen, dass tönt vielver-
sprechend! Was aber steckt wirklich hinter
der Aussage eines jungen österreichisch-
en Unternehmens, das besonders für die
Fahrzeugindustrie einen neuen Impuls
verleihen möchte? Grundsätzlich gibt es
keine neuen Batterien, dafür aber neuere
Technologien, die die volle Leistung der
Zellen, die auf Lithium-Ionen basieren,
durch ein kombiniertes Kühl- und Heiz-
system an den „Verbraucher“ abgeben
und die sich auch schneller laden lassen.
Gegenüber den bis jetzt größtenteils in
der Luftfahrt verwendeten Luftkühlungen
sind im Vergleich zwar keine sprunghaften
Gewinne zu erzielen, dafür verlängert
sich aber die Lebensdauer.
Die drei Brüder Kreisel im oberösterrei-
chischen Freistadt entwickelten diese
Idee einer modernen und in Zukunft
Experten gehen davon, dass die kombi-
nierte Flüssigkeitskühlung auch in Luftfahr-
zeugen mehr Sinn machen könnte, weil bei
niedrigen Außentemperaturen eine opti-

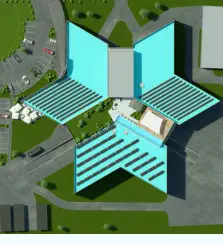
Neue Perspektiven
3D-Darstellung der Kreisel-Batterie
Plan des im Bau befindlichen Gebäudes
male Temperaturanpassung durch die
Beheizung gegeben sei. Auch zukünftige
andere Batteriesysteme, wie etwa die zu
erwartenden Magnesiumbatterien könn-
ten nach dem gleich Verfahren produziert
werden. Die Kreisel-Brüder müssen sich
jedenfalls derzeit keine Sorgen machen,
denn die großen Autokonzerne haben
bereits ein Auge auf deren Fertigungs-
verfahren geworfen.
vollautomatisierten Fertigung, die oben-
drein durch ein patentiertes Laser-
schweißverfahren spürbar billiger werden
soll. Gerade wurden die Grundmauern
für ein zehn Mio. Euro teures Fertigungs-
gebäude im Nachbarort gelegt, wo ab
2017 die Serie anlaufen soll.
Experimentiert wird in dem erst 2014 ge-
gründeten Unternehmen auf breiter Ba-
sis, primär allerdings auf dem Fahrzeug-
bereich. Markus Kreisel ließ aber wissen,
dass man bereit mit PC-Aero, Pipistrel
und anderen in Kontakt sei. Das Laser-
verfahren reduziert den Innenwiderstand,
sodass etwa mehr als 10% zusätzlich
nutzbare Kapazität zur Verfügung
stehen. In Zahlen ausgedrückt, kommt
das kreisel‘sche System auf 4,1 kg/kW
bei 1,95 l Volumen. (Vergleich: luftge-
kühlter Geiger Li-Io Akku mit 7,1 kWh-29
kg entspricht 4,085 kg/kW).
Serien-
Flugzeug-Batterie

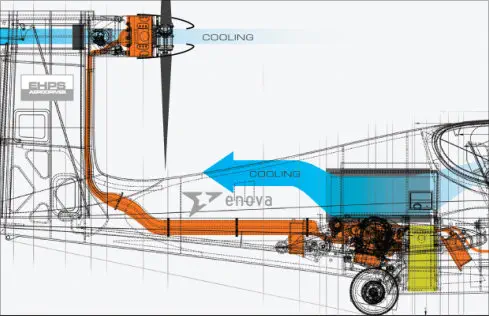



Aus Norwegen: Hybrid aus Design und geballter Technik
Eigentlich wollte der Norweger Tomas
Brødreskift nur ein nach seinen Vorstel-
lungen entwickeltes Amphibienflugzeug
entwickeln. Industriedesigner, wie er, seh-
en die Technikwelt mit anderen Augen.
Gefälliges Design steht für sie im Vorder-
grund, doch möchte der in unmittelbarer
Der komplette Antriebsstrang besteht aus
einem Zweischeiben Wankel-Diesel von
Wankel-Supertec, einem Generator und
E-Motor von Engiro, einem Lithium Ionen-
Batterie-System der Aachener Anlage-
technik und zur E-Motorsteuerung ein
Controller-System von der englischen Fir-
ma Sevcon. Für Engiro ist es das erste
Flugzeugprojekt! Sie kombinierten in dem
für Luftfahrtanwendungen speziell entwik-
kelten 34 Kilo E-Motor eine Luft-Wasser-
kühlung und entlocken dem getriebelosen
Motor 60 kW Dauerleistung und 97 kW bei
kurzzeitiger Höchstleistung mit 2400 RpM.
Die elektrische Energie erhält der E-Motor
über einen Generator, der von einem 60
kW Wankel-Motor angetrieben wird. Die
Batterie dinent allerdings nur als Puffer.
Die Redundanz hat die Aachner Firma
Engiro durch einen 6-phasigen Aufbau
mit je einem Controller gelöst. Nahezu
alle anderen Komponanten, wie auch die
Zelle selbst, wurden von Tomas Brødres
kift und seinen Helfern mihilfe eines Zu
schusses durch das „Transnova“-Pro-
gramm realisiert. Dennoch stecken be-
reit über 17 000 Arbeits-stunden in dem
Zwei sitzer, der nicht nur zwischen nor-
wegischen Fjorden im 130 kts-Tempo
schon im Frühjahr 2017 fliegen soll. Was
das Projekt letztendlich kosten wird, lässt
sich noch nicht absehen. Fliegt die Equ-
ator P2 erst einmal, und das ist für das
kommende Frühjahr geplant, möchte
Brødre skift gleich mit den
Vorserientypen be-ginnen, für die er
bereits zwei Investoren gewinnen
konnte. Sein ehrgeiziges Ziel ist es aber
erst einmal die AERO 2017 zu
beschicken.
Artist Impression der Equator P2 und wie sich Desiger Tomas Brødreskift sein zweisitziges Hybrid-Amphibium vorstellt
Hybrider Antriebsstrang für die Equator P2. Herzstück ist ein E-Motor im T-Leitwerk.
Nähe eines Fjordes bei Oslo sich mit ei-
nem reinen Flugzeug-Design nicht zufrie-
den geben. Ein neues Flugzeug, so be-
reits seine Überlegungen vor 6 Jahren,
sollte auch einen modernen Antrieb er-
halten. EHPS, Equator-Hybrid-Propulsion-
System nicht sich sein Hybrid-Antrieb.
Die Zelle vor dem Einbau der Komponenten im Frühsommer 2016
Ergonomie wird großgeschrieben!
Tomas Brødreskift bevorzugt den Sidestick
Foto: Equatoraircraft
Foto: Equatoraircraft
Zeichnung: Equatoraircraft
3D: Equatoraircraft

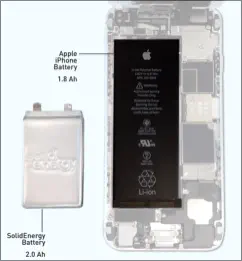
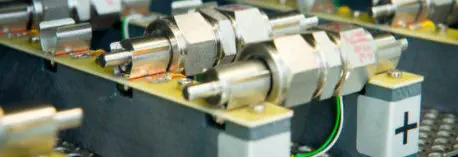
Energiedichten, Gewichte, Zuverlässigkeit,
Ladezyklen und letztendlich die Preise
werden den breiten Einsatz der
Elektromobilität bestimmen. Einen guten
Schritt weitergekommen ist man am
Massachu-setts Institute of Technology
(MIT) in USA, wo man eine Lithium-Metall-
Folie entwickelt hat, die Grafit-Anoden
ersetzen soll, die eine Mehrfaches an
Ionen aufnehmen kann. Der Vorteil der
Folie: sie ist dünner und leichter als
herkömmliche Materialien. Unter der
Leitung des Firmengründers Qichao Hu
entstand das Start-up-Unternehmen
SolidEnergy Systems, dass sich jetzt mit
der Serienreifmachung der neuartigen
Zellen beschäftig. "Mit der doppelten
Energiedichte können wir eine Batterie
bauen, die nur halb so groß ist und
trotzdem genauso lang durchhält wie ein
Lithi-um-Ionen-Akku", sagte Gründer Hu
im Gespräch mit den „MIT News". "Oder
wir bauen eine Batterie mit der gleichen
Größe, die doppelt so lang hält."
Schrittweise sollen Drohnen, Smartphones
und schon 2018 Elektroautos mit den neu
en Zellen ausgestattet werden, die Fahr-
zeuge bis zu 640 km fahren lassen
können.
Mehr Bewegung auf dem Batterie-Forschungs- und Entwicklungsektor: Kommt bald die Super-Batterie?
gen als falsch erweisen könnte. Dazu
zählen auch die Entwicklungen von Lithi-
um-Luft-Zellen, die Energiedichten von bis
zum 20-fachen Wert heutiger Zellen
erreichen sollen.
Einen Vorstoß hat Bosch mit dem Zukauf
des kalifornischen Batteriunternehmens
Seeo, ebenfalls ein Start-up-Unternehmen,
unternommen. Seeo entwickelte eine
nano-strukturierte Festpolymerelektrolyt-
Basis, die gegenüber herkömmlichen
Lithium-Ionen-Batterien keine flüssigen
Elektrolyten besitzen! Der 100%ige Zukauf
von Seeo war insofern außergewöhnlich,
weil das schwäbische Unter-nehmen in der
Regel nur 10 bis 25% in Start-up-
Unternehmen investiert. Derzeit investiert
Bosch jährlich 400 Millionen Euro in die
Elektromobilität. Die als Dry- Lyte Solid-
State-Batterie soll sich durch höhere
Zuverlässigkeit, sparsameren Verbrauch
von Ressourcen und als brandungefährlich
auszeichnen. Auch diese Zellen sollen
zwischen 400-500 Wh/kg gegenüber
heutigen Lithium-Io-nen-Zellen bringen.
Die volle Einsatzfähigkeit soll laut Seeo-
Bosch in einem Temperaturbereich von -40
Grad bis +70 Grad gewährleistet werden.
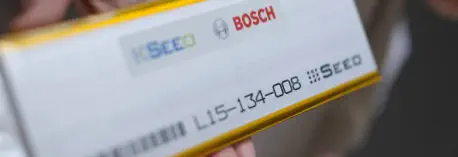
Demnächst erghältlich: kleinere Batterie
für das iPhone. Rechts die alte Zelle.
Versuchsaufbau von Lithium-Luft-Zellen am Helmholtz-Institut
Festkörper DryLyte Solid-State-Batterie der Bosch-Tochter Seeo in den USA
Selbst gängige Lithium-Ionen-Zellen
kommen derzeit nur auf etwa 130 -170
Wh/kg. In der Kraftfahrzeugindustrie ist
man aber nach wie vor unentschlossen,
welchen Zellen-typen, bzw. -entwicklungen
man den Vorrang geben soll, schließlich
möchte man auch nicht auf das falsche
Pferd setzen, weil Prognosen für die eine
oder andere Technologie sich schon mor-
in einem Temperaturbereich von -40 Grad
bis +70 Grad gewährleistet werden. Wann
diese Batterien herstellungreif, bzw.
marktfähig sind, ist noch nicht bekannt.
Bosch möchte mit der Schlüsseltechno-
logie der Speichertechnik aber einen Fuß
in der Tür haben, um nicht eines Tages
ins Hintertreffen zu gelangen.


Artist Impression: Equatoraircraft
Foto: Helmholtz Institut
Foto: Seeo/Bosch
Quelle: SolidEnergy
Foto: Siemens
Bild: Smartflyer
Bild: Kreisel
Foto: Kreisel
Bild: Kreisel



Akroflieger aus der
Schweiz
Air Zermatt Helikopter Pilot Thomas Pfam-
matter und Paragliding-Champion Domini-
que Steffen, Besitzer der Hangar 55 reali-
sierten gemeinsam mit Silence Aircraft,
Siemens und Hamilton das Elektroflug-
zeugprojekt aEro auf Basis der deutschen
Silence Twister. Da das Flugzeug auf -4g
bis +6g von Anfang an ausgelegt ist, kann
es überall in der Experimentalklasse zuge-
lassen werden. In der nun in dem Projekt
aEro vorgestellten Antriebseinheit von Sie-
mens kommt ein flüssigkeitsgekühlter 80
kW-Motor zum Einsatz, der leer 23 kg mit
einem Reduziergetriebe wiegt, doch müs-
sen weitere 160 kg an Batterien mit in die
Luft gebracht werden. Dennoch wiegt der
Einsitzer leer nur 310 kg. Doch nicht die
Batterie und der Elektromotor waren das
Neue für den spitfireähnlichen Vogel in
CFK-Bauweise, sondern die darauf spezi-
elle abzustimmende Elektronik für das Bat-
terie- und Motormanagementsystem. Für
eine mögliche Serie strebe man 100 kW
und mehr an, obwohl die jetzige 80kW
Version sich wie eine CAP 10 aber mit
besseren Leistungen fliegen ließe. Man sei
in der Lage, entweder bis zu eine Stunde
regulär zu fliegen oder etwa bis zu 35 Mi-
nuten anspruchsvollen Kunstflug damit zu
unternehmen. Die Präsentation erfolgte am
Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz unter
starker Mitwirkung des auch in Fliegerkrei-
sen bekannten Uhrenherstellers Hamilton.
Die E-Version der Silence ist äußerlich vom
Original kaum unterscheidbar
Dominique Steffen nach gelungener Demo.
Die Präsentation am Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz am 21.9 unter starker Mitwirkung des Uhrenherstellers Hamilton
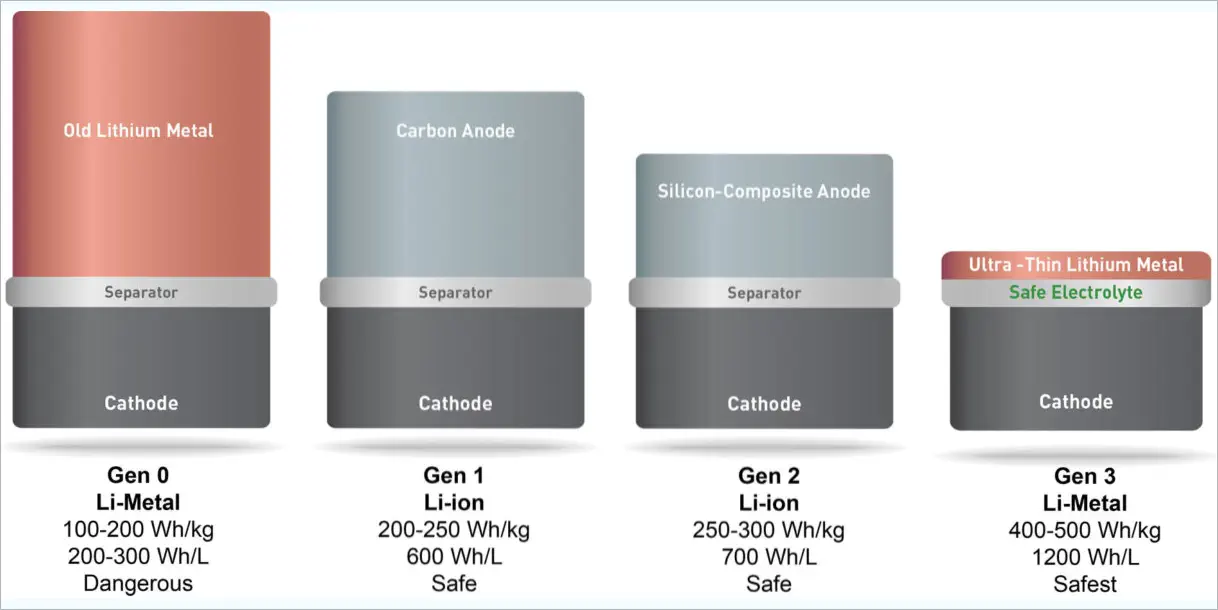

Foto: Hamilton/Michael Portmann
Foto: Hamilton/Michael Portmann
Foto: Hamilton/Michael Portmann
Grafik: Massachusetts Institute
of Technology (MIT)





Versuchsträger HY4 in Betrieb genommen
Offizieller Erstflug des Hybridflugzeug HY4 am 29.September 2016 am Flughafen Stuttgart.
Der doppelrümpfige Versuchsträger auf Basis der Pipistrel Taurus.
Symbolisches Anschieben der Wasserstoff-Brennstoffzellenflugzeugs HY4 des DLR
Prof. Fundel und Prof. Kallo
Ivo Boscarol und Prof. Kallo
Foto: Frank Herzog
Foto: DLR
Foto: Frank Herzog
Foto: Frank Herzog
Foto: Frank Herzog


Voltahelicopter ist eine Tochtergesellschaft
von Aquinea, eigentlich ein Unternehmen
für Schwimmbadtechnologien. Ausgangs-
lage war ein kleiner Hubschrauber mit ei-
nem Zweitaktmotor, der als Microcopter
MC1 unter anderem auch auf dem Aero-
salon in Paris auf einem Gemeinschafts-
stand gezeigt wurde, der jedoch nie von
Erfolg gekrönt war. 2009 entstand auch
eine Idee, dank der inzwischen verfügba-
ren Lithium-Zellen, diesen Helikopter auf
einen elektrischen Antrieb umzurüsten und
dies auch im Hinblick auf zukünftige Droh-
nen mit Drehflügelantrieb. Unter der Lei-
tung von Philippe Antoine wurde die Firma
Voltahelicopter gegründet. Man bediente
sich dabei der Zelle des Microcopter MC1
sowie dessen gesamten Rotorsystems. Mit
der staatlichen französischen Hochschule
für zivile Luftfahrt ENAC in Toulouse, der
SOFIZ Industrie und Protolec, AlphaVague
entstand das Konzept des Volta. Ein erster
kurzer Schwebeflug fand am 17.2. 2016
unter der Leitung von Héli-Horizon, einem
größeren franzö-ischen
port Paris-Issy-les-Moulineaux statt. Da-
bei hob die Ministerin für Umwelt und En-
ergie, Ségolène Royal hervor, dass sie in
Zukunft dieses innovative Projekt unter-
stützen wolle. Der ebenfalls anwesende
Generaldirektor für Zivilluftfahrt der DGCA
Gandil meinte, dass man neue Energie-
systeme in Zukunft mehr nutzen solle.
Das hieß mit anderen Worten, dass auch
die-sem Projekt staatliche Unterstützung
ge-währt werden wird. Angetrieben wird
der 520 kg schwere Hubschrauber von
einem 70 kW Enstrom Elektromotor, der
kurzzei-tig sogar 90 kw entwickeln kann.
Eine Lithium-Ionen-Batterie mit 22 kWh
(165 k) liefert die elektrische Energie.
Selbstverständlich möchte man die Versu-
che mit dem Einsitzer weiter fortführen.
Bis zu 15 Minuten Flugzeit seien drin.
Doch schon entstehen Pläne für einen
Doppelsitzer und einer Flugdauer von bis
zu 40 Minuten.

Französischer E-Heli
Mehr als nur ein Schwebeflug. “Volta” blieb bereits über 9 Minuten in der Luft.
Hubschrauberunternehmen statt. Mit 9
Minuten und 4 Sekunden fand nach
weiteren Modifikationen am 18. Oktober
2016 der offizielle Erstflug auf dem Heli-
Rechts: Konstrukteur Philippe Antoine.
Foto: Kreisel

Foto: Voltahelicopter
Foto: Voltahelicopter
Für Stuttgart war der Start der HY4 am
29. September eine kleine Sensation. Da
startete statt der Jets ein kleiner Viiersit-
zer ohne einen Tropfen Sprit. Der An-
triebsstrang des Flugzeugs besteht aus
einem Wasserstoffspeicher, einer Nieder-
temperatur-Wasserstoffbrennstoffzelle so-
wie einer Hochleistungsbatterie. Die
Brennstoffzelle wandelt die Energie des
Der Stuttgarter Flughafenchef gab mit der
Spende von 100.000 € die Initialzündung
zum Bau der HY4, die jetzt von der DLR-
Ausgründung H2FLY direkt betrieben wird
und auch die Zulassung betreut. Das Pro-
jekt wurde mit Mitteln des DLR und des
Stuttgarter Flughafens gefördert. Grundla-
gen der Brennstoffzellentechnologie fan-
den Unterstützung durch die Nationale Or-
ganisation Wasserstoff- und Brennstoffzel-
lentechnologie (NOW). "Mit der HY4 haben
wir nun eine optimale Plattform, um den
Einsatz der Brennstoffzelle im Flugzeug
weiterzuentwickeln", sagte Prof. Dr. Josef
Kallo, Leiter des Projektes HY4 im DLR
und Professor an der Universität Ulm.
"Kleine Passagierflugzeuge wie die HY4,
können sehr bald im Regionalverkehr als
Electric Air Taxis eingesetzt werden und
eine schnelle Alternative bieten."
Nicht ganz zufällig konzentrierte sich die
Suche nach einem geeigneten Erpro-
bungsträger, auf die aus zwei Taurus-
rümpfen bestehende Taurus G4, die unter
anderem den NASA Green Flight Chal-
lenge in October 2011 gewann. Das Flug-
zeug diente bei Pipistrel unter anderem
als Erprobungsträger für elektrische An-
triebe. Firmenchef Ivo Boscarol, Firmen-
chef von Pipistrel bot Prof. Josef Kallo am
gleichnamigen DLR tätig, das Flugzeug
an, weil es wie kein anders Flugzeug ide-
al geeigneter erschien. Unter der Lei-tung
Tine Tomažič, dem Leiter für Forschung
und Entwicklung Pipistrel wurde der Um-
bau des Flugzeug in einer am Flugplatz
Ajdovščina gelegenen Halle in einer
Rekordzeit durchgeführt. Wie Tomažič
zwi-schenzeitlich mal bemerkte, musste
das vorhandene Flugzeug vollkommen
ent-kernt wurden, damit anschließend die
Neuinstallationen für das Brennstoffzel-
lenflugzeug erfolgen konnten.
Treibstoffs Wasserstoff direkt in elektri-
sche Energie um. Als einziges Abfallpro-
dukt entsteht dabei Wasser. Mit dem ge-
wonnenen Strom treibt der 80 kW Elek-
tromotor den Propeller des Flugzeugs an.
Die an Bord mitgeführte Batterie liefert
zusätzlichen Strom während der Start-
und Steigphase.



Nach einer Entwicklungszeit von nicht ein-
mal 6 Monaten rüstete Tier 1 Engineering
in Kalifornien einen Hubschrauber vom
Typ Robinson R44 von einem serienmäs-
sigen Lycoming IO-540 Kolbenmotor auf
einen Elektroantrieb um. Die Einheit be-
steht aus zwei gekoppelten Synchronmo-
toren mit insgesamt 45 kg gegenüber dem
Kolbenmotor von 227 kg. Tier 1 Enginee-
ring ist ein Flugzeug-Design-und Entwick-
lungsunternehmen. Die bei dem R44 ver-
wendeten Lithium-Polymer-Batteriemo-
dule kamen von dem Zweiradhersteller
Brammo, die bereits sehr erfolgreich Elek-
tro-Motorräder produzieren. Nach zahlrei-
chen Bodentest hob Hubschraubertestpi-
lot Ric Webb am 21.9.2016 auf dem Los
Alamitos Army Airfield zu einen ausge-
dehnten kurzen Test-flug von fünf Minuten
ab. Der Hubschrauber kam auf eine Höhe
von 400 ft und erreichte eine Geschwin-

Robinson R44 fliegt elektrisch
R44: keine Spezialentwicklung, sondern nur ein serienmäßiger Viersitzer mit Batterien
man die Leistungen noch wesentlich zu
verbessern. Die Flugversuche sollen erst
2017 nach einigen Änderungen fortgesetzt
werden.
499 kg Batterien für 5 Minuten Flug

Bild: Voltahelicopter


ROD) beteiligt sind. Lung Biotechnology
PBC beabsichtigt, die EP-SAR-OD-Tech-
nologie zum Transport von Orga-nen mit
viel weniger Lärm und Kohlenstoff- Aus-
stoss als aktuelle Technologie es bietet,
anzuwenden. Robinson beteiligte sich
nicht am Erprobungsprogramm. Die Ab-
flugmasse des R44 lag bei 1134 kg, wobei
die 11 Batterien 499 kg wogen, die eine
Sp-annung von 700 Volt liefern. Nach
Abschlussmessungen stellte das Ingeni-
eurteam fest, dass bei dem 5-minütigem
Flug nur 20% der Batterieleistung ver-
braucht waren. Alle Flüge werden unter
einer speziellen Experimental-Zulassung
durch die FAA/Los Angeles MIDO über-
wacht. Die maximale Flugdauer des
Proof-of-Concept-Helis wird momentan
auf 20 Minuten oder etwa 30 Seemeilen
Reich-weite geschätzt. Mit höheren Ener-
giedichten der Batterien und ein effizien-
teres elektrisches Antriebssystem sowie
einer aero-dynamischeren Zelle erhofft
digkeit von 80 kts. Tier 1 Engineering führ-
te das Programm als Unterauftrag von
Lung Biotechnology PBC durch, die an
dem Electrically-Powered Semi-Autono-
mous Rotorcraft for Organ Delivery (EPSA-
hier zum
hier zum

Schweizer Event
Smartflyer Challenge, so nennt sich das
erste Fly-in für Elektroflugzeuge, dass in
diesem Jahr vom 9. bis 10 September in
Grenchen in der Schweiz stattfinden soll.
René Maier, Ex-Oberst der Schweizer
Armee und heutiger Präsident des erst
kürzlich gebildeten Organisationsteams für
eine jährlich geplante Veranstaltung am
Regionalflughafen Grenchen setzt auf
breites Interesse von Industrie, Forschung
und Besuchern.
Angeschlossen soll eine Fachtagung sein,
auf der neueste Technologien aus der ge-
samten Antriebstechnik sowie neue Flug-
zeug-Entwicklungen vorgestellt werden.
Da bereits einige Segelflugzeug-, Ecolight-
und Motorseglertypen und sowie Motorflug-
zeuge mit Elektroantrieb flügge geworden
sind, rechnet man auch auf rege Beteili-
gung und liebäugelt selbstverständlich nicht
nur mit den kleinen Herstellern, sondern
auch mit den großen Konzernen wie etwa
Airbus und Siemens, die sich längst
zukünftiger Antriebssysteme für Verkehrs-
flugzeuge ver-schrieben haben.
„Wir wollen Luftfahrzeuge mit elektrisch-
em Antrieb fördern und Grenchen um eu-
ropäischen Zentrum des Elektrofluges
machen“ erklärte René Maier kürzlich ge-
genüber Pressevertretern in Grenchen.


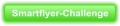
Foto: Mario Richard


Nach jahrelangen Bemühungen von Air-
bus Industrie den Einstieg in das Elektro-
flug-Zeitalter zu meistern, bei dem unter
anderem der E-Fan als Wegbereiter die-
nen sollte, wurde dieses Projekt im Früh-
jahr 2017 komplett aufgegeben. Fast zu
gleichen Zeit haben Italdesign und Airbus
am 7. März 2017 auf dem Auto-Salon in
Genf das Konzept Pop.-up vorgestellt.
Es war die Premiere des ersten modularen,
vollständig elektrischen und emissionsfreien
Verkehrssystem-Konzeptes, das die Ver-
kehrsberlastung in überfüllten Metropolen
lindern soll. Pop.Up sieht ein modulares Sy-
stem für den multimodalen Transport vor,
das Boden- und Luftverkehr vollständig kom-
biniert. Bis 2030 wird eine Zunahme von
Verkehrsstaus prognostiziert. Bei Fahrten
in Metropolen mit hoher Verkehrsdichte
trennt die Kapsel die Verbindung mit dem
Bodenmodul und wird durch ein mit acht
gegenläufigen Rotoren angetriebenes 5
mal 4,4 Meter großes Luftmodul aufge-
nommen und weiter fortbewegt. In dieser
Neue Airbus-Strategie
Konfiguration wird Pop.Up zu einem au-
tonomen Luftfahrzeug, das sich unter
Ausnutzung der dritten Dimension von A
nach B bewegt und Verkehrsstaus auf dem
Boden vermeidet. Die Lagereglung und
Kurssteuerung erfolgt nach gewohnten
Prinzipien.


Foto: Airbus
Foto: Airbus
Der zweimotorige
E-Fan sollte in
einer einer geän-
derten Version in
Serie gehen. Dazu
war ein eigenes
Werk in Frank-
reich geplant.
Jetzt arbeitet man
an neuen Konzep-
ten.
Electric Flight

Foto: H.Penner



- ILA 2024
- Birdy
- Paris Airshow
- Aero 2024
- Aero 2023
- Aero 2022
- Aero 2019
- Aero 2018
- Aero 2017
- Aero 2016
- Aero 2015
- Electrifly-In 2021
- Electrifly-In 2020
- Smartflyer Challenge 2018
- Smartflyer Challenge 2017
- Elektrofliegertreffen Greiling
- Neue Airbus Strategie
- Airbus-Testflieger
- Solar Impulse
- Yuneec
- Leisere Tragschrauber



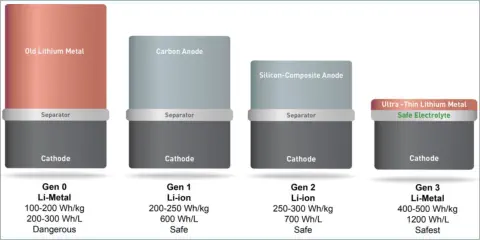
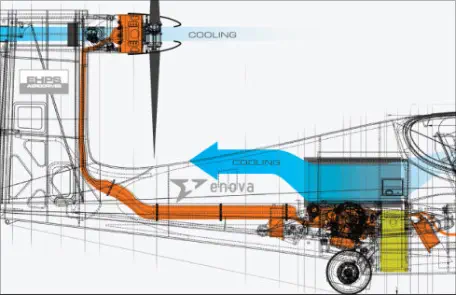




Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Neue Airbus Strategie…
Siemens entwickelt sich zum Leader
Anders als auf großen Luftfahrtmessen hat die führende General Aviation Messe AE-
RO das Thema der elektrischen Luftfahrtantriebe schon sehr früh erkannt und umge-
setzt. Flugzeughersteller wie auch Entwickler und Hersteller von E-Motoren, Controller
und Batteriemanagement-Systemen sind die Schlüssel zu einer vernünftigen Integra-
tion der elektrischen Antriebsstränge. Siemens hat bereits eine eigene Entwicklungs-
abteilung für Luftfahrtantriebe, sucht aber nun vermehrt die Nähe zu den Luftfahrzeug-
herstellern.
Nach einer ersten zögerlichen Präsentation im Jahr 2015 trumpfte man dieses Jahr
gleich mit einem großen Sonderstand auf der e-flight Expo auf, um über den Fortgang
der Entwicklungen die Besucher zu informieren. Kurz zuvor gab Siemens mit Airbus
bereits bekannt, dass man in München eine gemeinsame Entwicklungsfirma auf die
Beine stellen will, bei der ein hybrider Antriebsstrang im 10 MW-Bereich für zukünftige
Kleinverkehrsflugzeuge mit einer Kapazität von 60-100 Sitzen entwickelt werden soll.
Mit dem UL/LSA-Trainer eFusion aus Ungarn konnte man bereits über den Erstflug
berichten. Mit großer Spannung werden anschließend auch die Ergebnisse mit Extras
330 LE erwartet. Erst in der ersten Denkphase befindet sich die Integration eines Elek-
troantriebs in einen Koaxial-Hubschrauber der Firma Aerotec.
Siemens-Stand auf der AERO 2016. Im Vordergrund Extra 330 LE. Rechts oben
ungarischer Trainer eFusion.

Joe Kaeser
Tom Enders
Foto: Siemens
Vertrag zwischen Airbus und Siemens über mehrere hundert Millionen
Was ist eigentlich dran an diesem „Jahrhundert-Vertrag zwischens Siemens und Air-
bus, den seine beiden Vorstände am 7. April in München unterzeichneten? Zwar en-
gagierten sich beide Firmen schon gemeinsam in den vergangenen Jahren an kleine-
ren gemeinsamen Projekten, wie an der Katana und dem E-Fan, doch jetzt möchte
man richtig Nägel mit Köpfen machen. Für beide Global Player steht viel auf dem
Spiel, denn noch zehren sie von Althergebrachten. Natürlich möchte man auch noch
morgen und übermorgen in der oberen Liga mit-mischen, auch wenn als vordringlich-
es Ziel die Reduzierung der Treibhausgase als primäre Aufgabe angegeben wird.
Nein, hier geht es jetzt um Geld, um vielmehr Geld. Mit mehreren hundert Millionen
Euro bereitgesteller Mittel investieren diese Firmen in ihre eigene Zukunft. Trotz zur
Zeit niedriger Ölpreise weiß man um den letzten Tropfen Öl, der schon in einigen
Jahrzehnten nur noch unter großem Aufwand förderbar sein wird. Strahltriebwerke
werden zum Auslaufmodell. Die Flugzeuge der Zukunft werden nach Übereinstim-
mung aller Experten nur noch Elektroflugzeuge sein können, da keine andere Alterna-
tiven erkennbar sind. Anerkennend äußerte sich schon im letzten Jahr der Airbus-Vor-
stand gegenüber den kleinen Entwicklern, die in geduldsamer Feinarbeit erste brauch-
bare ein- und zweisitzige Flugzeuge entwickelten und die sich durchaus als elektrisch
angetriebene Flugzeuge für spezielle Aufgaben eigneten. Darauf möchte man jetzt
aufbauen.
Erst die Flugzeuge für die Allgemeine Luftfahrt entwickeln und dann Schritt für Schritt
zu den Kleinverkehrsflugzeugen durchstarten, das ist vordringliches Ziel dieser Kon-
zerne! Kompromisse sind angesagt,- noch keine reinelektrisch angetriebene Maschi-
nen, eher Hybridlösungen, wie jetzt die HYPSTAIR, die erst-mals auf der AERO in
Friedrichs-ha-fen gezeigt wurde, ebenfalls ein mit Siemens realisiertes Projekt. Das
Vertragswerk darf deshalb als richtiger Schritt in die Zukunft gesehen werden. Die jetzt
erst noch zu investierenden Millionen werden sich dann aber um ein bezahlt machen.
Foto: H.Penner


Swiss Flugkapitän und Milizionär-
Hubschrauber Pilot Rolf Stuber hat
seine Idee des viersitzigen Smart-
flyers mit Hybridantrieb weiter for-
cieren können. Ein erstes Versuchs-
muster soll mit Unterstützung durch
das Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL) realisiert werden. Die Hilfe
basiert zu einem großen Teil über
die Spezialfinanzierung Luftfahrt,
gemäß der Schweizer Bundesver-
fassung Artikel 86. Im Frühjahr grün-
dete Stuber eine AG nach Schweizer
Recht. Zunächst sind 1,2 Mio Fran-
ken veranschlagt.
Als erfahrener Pilot setzt Stuber aber
nicht auf einen konventionellen Kol-
benantriebe, sondern auf einen Hy-
bridantrieb. Inspiriert durch das Stutt-
garter Projekt des e-Genius sollen drei
Viersitzer mit Hybrid-Antrieb in der Vor-Planungsphase
Hauptkomponenten, ein kleiner Verbrennungsmotor mit Generator für den Dauerbe-
trieb, ein Batteriesystem und ein Elektromotor die Basis des Kunststoffflugzeugs bil-
den. Desgleichen schwört er auf ein Fallschirm-Gesamtrettungsystem. Der Reisevier-
sitzers soll nur 1/3 des üblichen Schadstoffausstosses produzieren. Nach dem bis
2020 fertig zu stellenden Proof-of-Concept (bei MSW Aviation in Wohlen) ist an den
Serienbau der Maschine gedacht.


Techn Daten: Smartflyer
Abmessungen
Spannweite:12 m
Länge: 8,30 m
Höhe: 2,70 m
Flügelfläche:13 m²
Flügelstreckung:11,07
Massen
Leermasse: 800 kg
Abflugmasse: 1120 kg
Zuladung: 320 kg
Antrieb: Hybrid
Elektromotor: max. 160 kW
konst. Leistung: 120 kW
Pufferbatterie. Li-Io.
Motor-Generator: Rotax 914

Aus Norwegen: Hybrid aus Design und geballter Technik
Eigentlich wollte der Norweger Tomas Brødreskift nur ein nach seinen Vorstellungen
entwickeltes Amphibienflugzeug entwickeln. Industriedesigner, wie er, sehen die Tech-
nikwelt mit anderen Augen. Gefälliges Design steht für sie im Vordergrund, doch
möchte der in unmittelbarer Nähe eines Fjordes bei Oslo sich mit einem reinen Flug-
zeug-Design nicht zufrieden geben. Ein neues Flugzeug, so bereits seine Überlegun-
gen vor 6 Jahren, sollte auch einen modernen Antrieb erhalten. EHPS, Equator-Hybrid-
Propulsion-System nicht sich sein Hybrid-Antrieb.
Der komplette Antriebsstrang besteht aus einem Zweischeiben Wankel-Diesel von
Wankel-Supertec, einem Generator und E-Motor von Engiro, einem Lithium Ionen-
Batterie-System der Aachener Anlagetechnik und zur E-Motorsteuerung ein Control-
ler-System von der englischen Firma Sevcon. Für Engiro ist es das erste Flugzeug-
projekt! Sie kom-binierten in dem für Luftfahrtanwendungen speziell entwik-kelten
34 Kilo E-Motor eine Luft-Wasserkühlung und entlocken dem getriebelosen Motor
60 kW Dauerleistung und 97 kW bei kurzzeitiger Höchstleistung mit 2400 RpM. Die
elektrische Energie erhält der E-Motor über einen Generator, der von einem 60 kW
Wankel-Motor angetrieben wird. Die Batterie dinent allerdings nur als Puffer.
Die Redundanz hat die Aachner Firma Engiro durch einen 6-phasigen Aufbau mit je
einem Controller gelöst. Nahezu alle anderen Komponanten, wie auch die Zelle selbst,
wurden von Tomas Brødres kift und seinen Helfern mihilfe eines Zu schusses durch
das „Transnova“-Pro-gramm realisiert. Dennoch stecken be-reit über 17 000 Arbeits-
stunden in dem Zwei sitzer, der nicht nur zwischen nor-wegischen Fjorden im 130 kts-
Tempo schon im Frühjahr 2017 fliegen soll. Was das Projekt letztendlich kosten wird,
lässt sich noch nicht absehen. Fliegt die Equ-ator P2 erst einmal, und das ist für das
kommende Frühjahr geplant, möchte Brødre skift gleich mit den Vorserientypen be-
ginnen, für die er bereits zwei Investoren gewinnen konnte. Sein ehrgeiziges Ziel ist es
aber erst einmal die AERO 2017 zu beschicken.
Foto: Equatoraircraft
Zeichnung: Equatoraircraft

Energiedichten, Gewichte, Zuverlässigkeit, Ladezyklen und letztendlich die Preise
werden den breiten Einsatz der Elektromobilität bestimmen. Einen guten Schritt
weitergekommen ist man am Massachu-setts Institute of Technology (MIT) in USA, wo
man eine Lithium-Metall-Folie entwickelt hat, die Grafit-Anoden ersetzen soll, die eine
Mehrfaches an Ionen aufnehmen kann. Der Vorteil der Folie: sie ist dünner und leichter
als herkömmliche Materialien. Unter der Leitung des Firmengründers Qichao Hu
entstand das Start-up-Unternehmen SolidEnergy Systems, dass sich jetzt mit der
Serienreifmachung der neuartigen Zellen beschäftig. "Mit der doppelten Energiedichte
können wir eine Batterie bauen, die nur halb so groß ist und trotzdem genauso lang
durchhält wie ein Lithi-um-Ionen-Akku", sagte Gründer Hu im Gespräch mit den „MIT
News". "Oder wir bauen eine Batterie mit der gleichen Größe, die doppelt so lang hält."
Schrittweise sollen Drohnen, Smartphones und schon 2018 Elektroautos mit den neu
en Zellen ausgestattet werden, die Fahr-zeuge bis zu 640 km fahren lassen können.
gen als falsch erweisen könnte. Dazu zählen auch die Entwicklungen von Lithi-um-Luft-
Zellen, die Energiedichten von bis zum 20-fachen Wert heutiger Zellen erreichen sollen.
Einen Vorstoß hat Bosch mit dem Zukauf des kalifornischen Batteriunternehmens
Seeo, ebenfalls ein Start-up-Unternehmen, unternommen. Seeo entwickelte eine nano-
strukturierte Festpolymerelektrolyt-Basis, die gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-
Batterien keine flüssigen Elektrolyten besitzen! Der 100%ige Zukauf von Seeo war
insofern außergewöhnlich, weil das schwäbische Unter-nehmen in der Regel nur 10 bis
25% in Start-up-Unternehmen investiert. Derzeit investiert Bosch jährlich 400 Millionen
Euro in die Elektromobilität. Die als Dry- Lyte Solid-State-Batterie soll sich durch höhere
Zuverlässigkeit, sparsameren Verbrauch von Ressourcen und als brandungefährlich
auszeichnen. Auch diese Zellen sollen zwischen 400-500 Wh/kg gegenüber heutigen
Lithium-Io-nen-Zellen bringen. Die volle Einsatzfähigkeit soll laut Seeo-Bosch in einem
Temperaturbereich von -40 Grad bis +70 Grad gewährleistet werden.
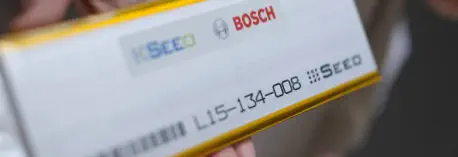
Festkörper DryLyte Solid-State-Batterie der Bosch-Tochter Seeo in den USA
Selbst gängige Lithium-Ionen-Zellen kommen derzeit nur auf etwa 130 -170 Wh/kg. In
der Kraftfahrzeugindustrie ist man aber nach wie vor unentschlossen, welchen Zellen-
typen, bzw. -entwicklungen man den Vorrang geben soll, schließlich möchte man auch
nicht auf das falsche Pferd setzen, weil Prognosen für die eine oder andere Technologie
sich schon mor-
Wann diese Batterien herstellungreif, bzw. marktfähig sind, ist noch nicht bekannt.
Bosch möchte mit der Schlüsseltechnologie der Speichertechnik aber einen Fuß in
der Tür haben, um nicht eines Tages ins Hintertreffen zu gelangen.

Foto: Seeo/Bosch
Bild: Smartflyer
Akroflieger aus der Schweiz
Air Zermatt Helikopter Pilot Thomas Pfammatter und Paragliding-Champion Domini-
que Steffen, Besitzer der Hangar 55 realisierten gemeinsam mit Silence Aircraft, Sie-
mens und Hamilton das Elektroflugzeugprojekt aEro auf Basis der deutschen Silence
Twister. Da das Flugzeug auf -4g bis +6g von Anfang an ausgelegt ist, kann es überall
in der Experimentalklasse zugelassen werden. In der nun in dem Projekt aEro vorge-
stellten Antriebseinheit von Siemens kommt ein flüssigkeitsgekühlter 80 kW-Motor zum
Einsatz, der leer 23 kg mit einem Reduziergetriebe wiegt, doch müssen weitere 160 kg
an Batterien mit in die Luft gebracht werden. Dennoch wiegt der Einsitzer leer nur 310
kg. Doch nicht die Batterie und der Elektromotor waren das Neue für den spitfireähn-
lichen Vogel in CFK-Bauweise, sondern die darauf spezielle abzustimmende Elektronik
für das Batterie- und Motormanagementsystem. Für eine mögliche Serie strebe man
100 kW und mehr an, obwohl die jetzige 80kW Version sich wie eine CAP 10 aber mit
besseren Leistungen fliegen ließe. Man sei in der Lage, entweder bis zu eine Stunde
regulär zu fliegen oder etwa bis zu 35 Minuten anspruchsvollen Kunstflug damit zu
unternehmen. Die Präsentation erfolgte am Flugplatz Raron bei Zermatt/Schweiz unter
starker Mitwirkung des auch in Fliegerkreisen bekannten Uhrenherstellers Hamilton.

Foto: Hamilton/Michael Portmann
Grafik: Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
Versuchsträger HY4 in Betrieb genommen
Offizieller Erstflug des Hybridflugzeug HY4 am 29.September 2016 am Flughafen Stuttgart.
Foto: Frank Herzog


Voltahelicopter ist eine Tochtergesellschaft von Aquinea, eigentlich ein Unternehmen
für Schwimmbadtechnologien. Ausgangslage war ein kleiner Hubschrauber mit einem
Zweitaktmotor, der als Microcopter MC1 unter anderem auch auf dem Aerosalon in
Paris auf einem Gemeinschaftsstand gezeigt wurde, der jedoch nie von Erfolg gekrönt
war. 2009 entstand auch eine Idee, dank der inzwischen verfügbaren Lithium-Zellen,
diesen Helikopter auf einen elektrischen Antrieb umzurüsten und dies auch im Hinblick
auf zukünftige Drohnen mit Drehflügelantrieb. Unter der Leitung von Philippe Antoine
wurde die Firma Voltahelicopter gegründet. Man bediente sich dabei der Zelle des
Microcopter MC1 sowie dessen gesamten Rotorsystems. Mit der staatlichen franzö-
sischen Hochschule für zivile Luftfahrt ENAC in Toulouse, der SOFIZ Industrie und
Protolec, AlphaVague entstand das Konzept des Volta.
Ein erster kurzer Schwebeflug fand am 17.2. 2016 unter der Leitung von Héli-Horizon,
einem größeren französischen Hubschrauberunternehmen statt. Mit 9 Minuten und 4
Sekunden fand nach weiteren Modifikationen am 18. Oktober 2016 der offizielle Erst-
flug auf dem Heliport Paris-Issy-les-Moulineaux statt. Dabei hob die Ministerin für
Umwelt und Energie, Ségolène Royal hervor, dass sie in Zukunft dieses innovative
Projekt unter-stützen wolle. Der ebenfalls anwesende Generaldirektor für Zivilluftfahrt
der DGCA Gandil meinte, dass man neue Energiesysteme in Zukunft mehr nutzen
solle. Das hieß mit anderen Worten, dass auch diesem Projekt staatliche Unterstütz-
ung ge-währt werden wird. Angetrieben wird der 520 kg schwere Hubschrauber von
einem 70 kW Enstrom Elektromotor, der kurzzeitig sogar 90 kw entwickeln kann. Eine
Lithium-Ionen-Batterie mit 22 kWh (165 k) liefert die elektrische Energie. Selbstver-
ständlich möchte man die Versuche mit dem Einsitzer weiter fortführen. Bis zu 15 Mi-
nuten Flugzeit seien drin. Doch schon entstehen Pläne für einen Doppelsitzer und ei-
ner Flugdauer von bis zu 40 Minuten.
Französischer E-Heli
Foto: Voltahelicopter
Für Stuttgart war der Start der HY4 am
29. September eine kleine Sensation. Da
startete statt der Jets ein kleiner Viersit-
zer ohne einen Tropfen Sprit. Der An-
triebsstrang des Flugzeugs besteht aus
einem Wasserstoffspeicher, einer Nieder-
temperatur-Wasserstoffbrennstoffzelle
sowie einer Hochleistungsbatterie. Die
Der Stuttgarter Flughafenchef gab mit der Spende von 100.000 € die Initialzündung
zum Bau der HY4, die jetzt von der DLR-Ausgründung H2FLY direkt betrieben wird
und auch die Zulassung betreut. Das Projekt wurde mit Mitteln des DLR und des
Stuttgarter Flughafens gefördert. Grundlagen der Brennstoffzellentechnologie fanden
Unterstützung durch die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (NOW). "Mit der HY4 haben wir nun eine optimale Plattform, um den Ein-
satz der Brennstoffzelle im Flugzeug weiterzuentwickeln", sagte Prof. Dr. Josef Kallo,
Leiter des Projektes HY4 im DLR und Professor an der Universität Ulm. "Kleine Passa-
gierflugzeuge wie die HY4, können sehr bald im Regionalverkehr als Electric Air Taxis
eingesetzt werden und eine schnelle Alternative bieten."
Nicht ganz zufällig konzentrierte sich die Suche nach einem geeigneten Erpro-
bungsträger, auf die aus zwei Taurus-rümpfen bestehende Taurus G4, die unter
anderem den NASA Green Flight Chal-lenge in October 2011 gewann. Das Flug-zeug
diente bei Pipistrel unter anderem als Erprobungsträger für elektrische An-triebe.
Firmenchef Ivo Boscarol, Firmen-chef von Pipistrel bot Prof. Josef Kallo am
gleichnamigen DLR tätig, das Flugzeug an, weil es wie kein anders Flugzeug ide-al
geeigneter erschien. Unter der Lei-tung Tine Tomažič, dem Leiter für Forschung und
Entwicklung Pipistrel wurde der Um-bau des Flugzeug in einer am Flugplatz Ajdovščina
gelegenen Halle in einer Rekordzeit durchgeführt. Wie Tomažič zwi-schenzeitlich mal
bemerkte, musste das vorhandene Flugzeug vollkommen ent-kernt wurden, damit
anschließend die Neuinstallationen für das Brennstoffzel-lenflugzeug erfolgen konnten.
Brennstoffzelle wandelt die Energie des
Treibstoffs Wasserstoff direkt in elektrische
Energie um. Als einziges Abfallprodukt ent-
steht dabei Wasser. Mit dem gewonnenen
Strom treibt der 80 kW Elektromotor den
Propeller des Flugzeugs an. Die an Bord
mitgeführte Batterie liefert zusätzlichen
Strom während der Start- und Steigphase.



Nach einer Entwicklungszeit von nicht ein-mal 6 Monaten rüstete Tier 1 Engineering in
Kalifornien einen Hubschrauber vom Typ Robinson R44 von einem serienmäßigen Ly-
coming IO-540 Kolbenmotor auf einen Elektroantrieb um. Die Einheit besteht aus zwei
gekoppelten Synchronmotoren mit insgesamt 45 kg gegenüber dem Kolbenmotor von
227 kg. Tier 1 Engineering ist ein Flugzeug-Design-und Entwicklungsunternehmen.
Die bei dem R44 verwendeten Lithium-Polymer-Batteriemo-dule kamen von dem Zwei-
radhersteller Brammo, die bereits sehr erfolgreich Elektro-Motorräder produzieren.
Nach zahlreichen Bodentest hob Hubschraubertestpilot Ric Webb am 21.9.2016 auf
dem Los Alamitos Army Airfield zu einen ausgedehnten kurzen Testflug von fünf Mi-
nuten ab. Der Hubschrauber kam auf eine Höhe von 400 ft und erreichte eine Ge-
schwindigkeit von 80 kts. Tier 1 Engineering führte das Programm als Unterauftrag
von Lung Biotechnology PBC durch, die an dem Electrically-Powered Semi-Autono-
mous Rotorcraft for Organ Delivery (EPSA-ROD) beteiligt sind. Lung Biotechnology
PBC beabsichtigt, die EP-SAR-OD-Technologie zum Transport von Organen mit viel
weniger Lärm und Kohlenstoff- Ausstoss als aktuelle Technologie es bietet, anzuwen-
den. Robinson beteiligte sich nicht am Erprobungsprogramm.
Die Abflugmasse des R44 lag bei 1134 kg, wobei die 11 Batterien 499 kg wogen, die
eine Sp-annung von 700 Volt liefern. Nach Abschlussmessungen stellte das Ingeni-
eurteam fest, dass bei dem 5-minütigem Flug nur 20% der Batterieleistung verbraucht
waren. Alle Flüge werden unter einer speziellen Experimental-Zulassung durch die
FAA/Los Angeles MIDO überwacht. Die maximale Flugdauer des Proof-of-Concept-
Helis wird momentan auf 20 Minuten oder etwa 30 Seemeilen Reichweite geschätzt.
Mit höheren Energiedichten der Batterien und ein effizienteres elektrisches Antriebs-
system sowie einer aerodynamischeren Zelle erhofft man die Leistungen noch we-
sentlich zu verbessern. Die Flugversuche sollen erst 2017 nach einigen Änderungen
fortgesetzt werden.
Robinson R44 fliegt elektrisch
Bild: Voltahelicopter
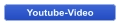


Nach jahrelangen Bemühungen von Airbus Industrie den Einstieg in das Elektroflug-Zeit-
alter zu meistern, bei dem unter anderem der E-Fan als Wegbereiter dienen sollte, wurde
dieses Projekt im Frühjahr 2017 komplett aufgegeben. Fast zu gleichen Zeit haben Ital-
design und Airbus am 7. März 2017 auf dem Auto-Salon in Genf das Konzept Pop-up vor-
gestellt.
Es war die Premiere des ersten modularen, vollständig elektrischen und emissionsfreien
Verkehrssystem-Konzeptes, das die Verkehrsberlastung in überfüllten Metropolen lindern
soll. Pop.Up sieht ein modulares System für den multimodalen Transport vor, das Boden-
und Luftverkehr vollständig kombiniert. Bis 2030 wird eine Zunahme von Verkehrsstaus
prognostiziert. Bei Fahrten in Metropolen mit hoher Verkehrsdichte trennt die Kapsel die
Verbindung mit dem Bodenmodul und wird durch ein mit acht gegenläufigen Rotoren
angetriebenes 5 mal 4,4 Meter großes Luftmodul aufgenommen und weiter fortbewegt. In
dieser Konfiguration wird Pop.Up zu einem autonomen Luftfahrzeug, das sich unter Aus-
nutzung der dritten Dimension von A nach B bewegt und Verkehrsstaus auf dem Boden
vermeidet. Die Lagereglung und Kurssteuerung erfolgt nach gewohnten Prinzipien.
Neue Airbus-Strategie
Foto: Airbus
Electric Flight